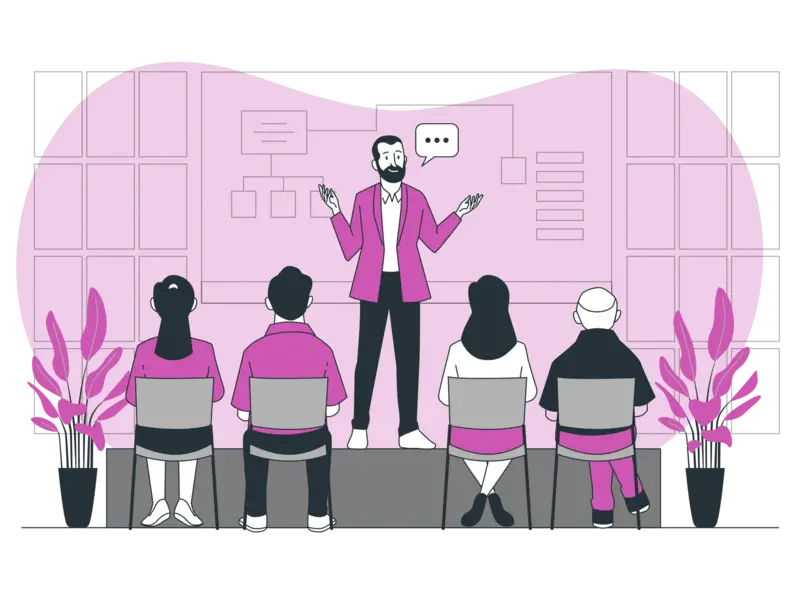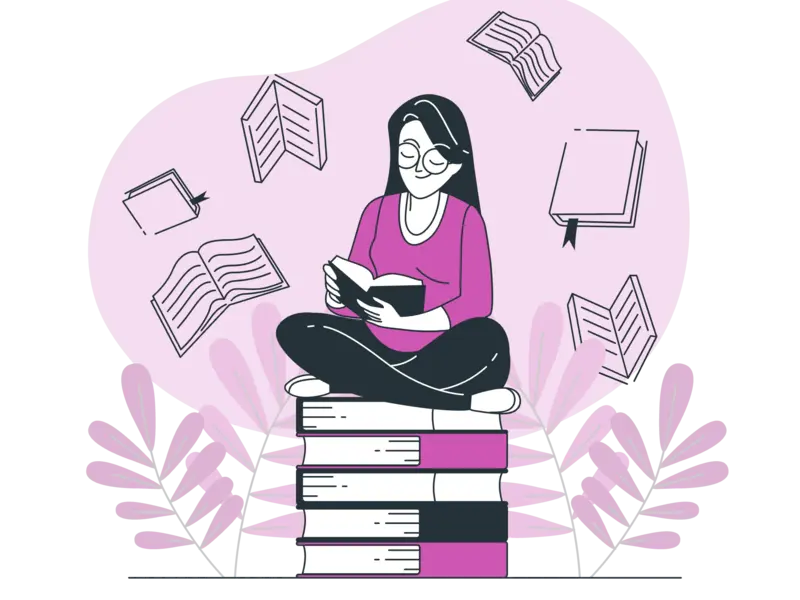Wie tickt Deutschland – im Osten, im Westen und insgesamt?
Gegenstand des Deutschland-Monitors ist eine jährlich wiederholte, regional differenzierte und konsekutiv im zeitlichen Längsschnitt vergleichend angelegte Untersuchung, mit der die Beständigkeit und die Veränderungen von politischen und gesellschaftlichen Stimmungslagen und Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger in Ost- und Westdeutschland empirisch erhoben und wissenschaftlich analysiert werden. Ausgangspunkt und analytischer roter Faden des Projekts ist die folgende Frage: Inwiefern beeinflussen regionale Lebensumfelder (»Kontexte«) die gesellschaftlichen und politischen Einstellungen dort lebender Menschen?
Key Findings
Der Deutschland-Monitor widmet sich 2025 dem Schwerpunkt „Wie veränderungsbereit ist Deutschland?“. Im Mittelpunkt steht dabei sowohl die allgemeine gesellschaftliche Veränderungsbereitschaft als auch die in spezifischen Politikfeldern. Analysiert wurde unter anderem, ob Veränderungen als zu umfassend, zu schnell oder zu tiefgreifend empfunden werden bzw. ob sie eher als Chance oder Risiko wahrgenommen werden. Zudem wurde untersucht welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Bürgerinnen und Bürger bereit sind, gesellschaftliche Veränderungen mitzutragen oder auch aktiv mitzugestalten. Darüber hinaus erhebt und untersucht der Deutschland-Monitor wie in jedem Jahr zentrale, in der Sozial- und Politikwissenschaft etablierte Einstellungskonzepte wie Demokratiezufriedenheit, Vertrauen in politische Institutionen oder populistische Einstellungen. Darüber hinaus werden gesellschaftliche Einstellungen, etwa zum sozialen Zusammenhalt sowie zur individuellen Lebenszufriedenheit erfasst. Die Befunde des aktuellen Deutschland-Monitors basieren auf drei eng miteinander verknüpften Erhebungsformaten: einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung, einer regionalen Vertiefungsstudie in strukturstarken und strukturschwachen Kreisen Ost- und Westdeutschlands sowie Fokusgruppendiskussionen. Darauf aufbauend kommt der Deutschland-Monitor 2025 zu folgenden zentralen Untersuchungsergebnissen (Key Findings):
Keine generelle Veränderungsmüdigkeit
Deutschland befindet sich nicht in einem Zustand von Veränderungsmüdigkeit. Ein knappes Viertel (23 %) der Befragten ist vielmehr offen und bereit für gesellschaftlichen Wandel und nimmt diesen tendenziell als gesellschaftliche Chance wahr. Mehr als die Hälfte (52 %) steht dem Wandel ambivalent gegenüber, indem sie weder klar positive noch ausgeprägt negative Bewertungen vornimmt. Ein Viertel (26 %) steht dem Wandel grundsätzlich kritisch bis ablehnend gegenüber und verbindet Veränderungen primär mit gesellschaftlichen Risiken.
Transformationstypen in Ost-, West- und Gesamtdeutschland
West
Ost
Gesamtdeutschland
Hohe Ähnlichkeit zwischen Ost und West
Die allgemeine Veränderungsbereitschaft ist in Ost- und Westdeutschland sehr ähnlich ausgeprägt. Allerdings äußern Bürgerinnen und Bürger in strukturschwachen Gebieten in Ostdeutschland eine deutlich geringere Veränderungsbereitschaft als jene in den strukturstarken Regionen in Ostdeutschland. In diesen strukturstarken ostdeutschen Kreisen liegt die Veränderungsbereitschaft auf demselben Niveau wie in den westdeutschen Kreisen – unabhängig davon, ob diese strukturstark oder strukturschwach sind.
Verteilung der Transformationstypen nach Prosperität anhand der regionalen Vertiefungsstudie
West, hohe Prosperität
West, geringe Prosperität
Ost, hohe Prosperität
Ost, geringe Prosperität
Allgemeine Veränderungsbereitschaft prägt Politikfelder
Die allgemeine Veränderungsbereitschaft prägt den Blick auf aktuelle gesellschaftliche Veränderungen in den 6 untersuchten Politikfeldern Verteidigung, Wirtschaft, Digitalisierung, Demografie, Klima und Migration. Diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die allgemein veränderungsbereiter sind, unterstützen auch konsistent stärker gegenwärtige und zukünftige Veränderungen in diesen gesellschaftlichen Bereichen.
Spezifische Veränderungsbereitschaft in ausgewählten Politikfeldern nach Transformationstypen
Zumutungen tragbar – Ausnahme: die Rente
Veränderungen gehen in der Regel auch mit Zumutungen einher, z. B. höheren Steuern für Verteidigungsausgaben, Verzicht auf den Verbrenner-Motor für den Klimaschutz oder einem Arbeitsplatzwechsel. Die Bürgerinnen und Bürger sind in den 6 untersuchten Politikfeldern dennoch mehrheitlich bereit, diese Zumutungen ganz oder zumindest teilweise mitzutragen. Eine Ausnahme besteht in Bezug auf die Frage, ob die Befragten angesichts des demografischen Wandels bereit wären, für die gleiche Rentenhöhe länger zu arbeiten. Dies lehnen 58 Prozent der Befragten ab und empfinden es als zu große Zumutung.
Zumutungsaversion in unterschiedlichen Politikbereichen
Es wäre für mich eine Zumutung, wenn...
ich für die gleiche Höhe der Rente länger arbeiten muss.
ich für den Klimaschutz kein Auto mit Verbrenner-Motor mehr fahren darf.
ich für Verteidigung mehr Steuern zahlen müsste.
ich alltägliche Dinge nur noch digital erledigen kann.
ich mich beruflich neu orientieren muss.
in meiner Nachbarschaft eine Flüchtlingsunterkunft eingerichtet wird.
Zuversicht prägt Veränderungsbereitschaft
Menschen, die eher veränderungsbereit sind, verfügen im Durchschnitt über etwas mehr Einkommen und Bildung. Sie bewerten aktuell sowohl ihre persönliche wirtschaftliche Lage als auch die wirtschaftliche Lage Deutschlands positiver. Wer selbst durch gesellschaftliche Veränderungen negative Erfahrungen gemacht hat, steht auch zukünftigen Veränderungen eher skeptisch gegenüber. Wichtiger als die Bewertung dieser früheren Erfahrungen und aktuellen Gegebenheiten ist jedoch die Zukunftserwartung der Bürgerinnen und Bürger. Wer von einer positiven Entwicklung für sich selbst und insbesondere für Deutschland ausgeht, steht den gesellschaftlichen Veränderungen deutlich positiver gegenüber als jene, die mit Sorgen in die Zukunft blicken. Der sorgenvolle Blick in die Zukunft ist also gerade kein Motor für Veränderungsbereitschaft.
Zukunftserwartung nach Transformationstypen
Zukunftserwartung: Deutschland
Transformationsbefürworter (Typ 1)
Transformationsoffene (Typ 2)
Transformationsambivalente (Typ 3)
Transformationskritiker (Typ 4)
Bewahrungsorientierte (Typ 5)
Zukunftserwartung: Persönlich
Transformationsbefürworter (Typ 1)
Transformationsoffene (Typ 2)
Transformationsambivalente (Typ 3)
Transformationskritiker (Typ 4)
Bewahrungsorientierte (Typ 5)
Anteil (%)
Sicherheit und Fairness steigern Akzeptanz von Wandel
Politikfeldübergreifend werden Veränderungen eher akzeptiert, wenn der Staat als handlungsfähig und gestaltend empfunden wird, die Entscheidungen nachvollziehbar und transparent kommuniziert und als angemessen bzw. gerecht wahrgenommen werden. Zudem ist Sicherheit für transformationsbereite wie -skeptische Bürgerinnen und Bürger eine zentrale Bezugsdimension in allen untersuchten Bereichen. Dazu gehören z. B. eine sichere Rente, Energie- oder Datensicherheit sowie die eigene körperliche Sicherheit.
Bedeutung des Wertes Sicherheit für die Befragten
Wie wichtig ist für uns Sicherheit? Also: Schutz, Harmonie und Stabilität der Gesellschaft, von persönlichen Beziehungen und der eigenen Person?
Anteil (%)
Demokratie gilt grundsätzlich als transformationsfähig
In den Fokusgruppendiskussionen hat sich gezeigt, dass die „Transformationskompetenz“ der Demokratie nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird. Doch bestehen vielerorts Zweifel daran, dass die Demokratie und ihre handelnden Akteure hierzulande den transformativen Herausforderungen der Gegenwart gewachsen sind. Der Erfolg von Transformationsprozessen hängt somit wesentlich auch davon ab, dass auch die abwägenden und teilweise verunsicherten Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden. Mögliche Ansätze dafür sind u. a. Effizienzsteigerungen, eine bessere Rückkopplung der Politik an die Bevölkerung und mehr direktdemokratische Beteiligungs- und Entscheidungsformate.

Demokratie beliebt, Umsetzung umstritten
Nach wie vor gibt es eine sehr hohe Zustimmung zur Idee der Demokratie in Deutschland (98 %). Mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland sind deutlich weniger Menschen zufrieden (60 %). Dieser Wert ist für Westdeutschland in den vergangenen 3 Jahren weitgehend stabil. Für Ostdeutschland ist der Grad der Zufriedenheit geringer (51 %), hat aber in den vergangenen Jahren bedeutsam zugenommen (2023: 43 %). Die Zufriedenheit mit der Demokratie, ihren Akteuren und Institutionen hängt insgesamt stark von der wahrgenommenen wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, der wahrgenommenen individuellen Anerkennung sowie den persönlichen Zukunftserwartungen ab.
Einstellungen zur Demokratie in Ost-, West- und Gesamtdeutschland
Demokratieidee***
West
Ost
Gesamtdeutschland
Verfassungsordnung***
West
Ost
Gesamtdeutschland
Funktionieren der Demokratie***
West
Ost
Gesamtdeutschland
Abweichungen zu 100 Prozent sind rundungsbedingt. Die Antwortkategorien zur Demokratieidee lauteten „entschieden für Demokratie“, „eher für Demokratie“, „eher gegen Demokratie“ und „entschieden gegen Demokratie“. Das Signifikanzniveau bezieht sich auf den Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. *** p< 0,001; ** p <0,01; * p< 0,05.
Populismus verstärkt Demokratieskepsis
Die Entwicklung der Demokratie in Deutschland sehen die Menschen eher kritisch. Insgesamt 71 Prozent der Bevölkerung stellen für die letzten 10 Jahre eher eine negative Entwicklung fest. Populistisch eingestellte Personen sehen die Entwicklung der Demokratie signifikant häufiger negativ (85 %) als Personen, die keine populistischen Einstellungen teilen (67 %).
Subjektive Entwicklung der Demokratie in Deutschland in den letzten zehn Jahren in Ost-, West- und Gesamtdeutschland.
West
Ost
Gesamtdeutschland
Anteil (%)
Lebenszufriedenheit ist überwiegend sozial geprägt
Die subjektive Lebenszufriedenheit ist neben objektiven Statusmerkmalen wie Einkommen und Bildung vor allem von Wahrnehmungen der Stabilität der eigenen Lebenslage, sozialer Anerkennung und gefühlter sozialer Gerechtigkeit geprägt. Auch eine positive Bewertung der Wiedervereinigung geht – insbesondere in Ostdeutschland – mit höherer Lebenszufriedenheit einher. Grundsätzlich sind Ost-West-Unterschiede in der Lebenszufriedenheit minimal. In ostdeutschen Kreisen mit niedriger Prosperität fällt jedoch die Lebenszufriedenheit etwas geringer aus.
Lebenszufriedenheit nach unterschiedlichen Indikatoren
Landesteil***
Deprivationsempfinden***
Statusverlustangst***
Nettoäquivalenzeinkommen***
Regionale Prägungen und Differenzen vor allem im Osten
Ein konsistentes Ergebnis der regionalen Vertiefungsstudie ist, dass die Einstellungen in den strukturstarken und -schwachen Regionen Westdeutschlands ebenso wie in den strukturstarken Regionen in Ostdeutschland sehr ähnlich sind. Die strukturschwachen Regionen in Ostdeutschland weichen hiervon jedoch in der Regel deutlich ab. So ist dort u. a. die Demokratiezufriedenheit signifikant geringer, populistische Einstellungen sind weiter verbreitet, das Gefühl individueller und gesellschaftlicher Anerkennung ist deutlich geringer und Veränderungen werden stärker mit Risiken verbunden. Daher könnten eine gezielte Regionalförderung zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und eine stärkere Anerkennung von ostdeutschen Lebensleistungen mögliche Ansatzpunkte sein.
Indikatoren politischer Unterstützung nach Prosperität anhand der regionalen Vertiefungsstudie
Demokratietypen***
Ost, geringe Prosperität
Ost, hohe Prosperität
West, geringe Prosperität
West, hohe Prosperität
Anteil (%)
Institutionsvertrauen***
Ost, geringe Prosperität
Ost, hohe Prosperität
West, geringe Prosperität
West, hohe Prosperität
Anteil (%)
Nahes Umfeld wird besser bewertet als Gesellschaft
Insgesamt zeigt der Deutschland-Monitor erneut das Ergebnis, dass die eigene und direkt erfahrbare Situation durchweg – zumeist sogar deutlich – positiver bewertet wird als die gesamtgesellschaftliche Situation. Dies gilt u. a. sowohl für die Einschätzung der aktuellen eigenen wirtschaftlichen Lage und jener in Deutschland als auch für den sozialen Zusammenhalt vor Ort und im Land. Ebenso werden die eigenen bzw. das eigene Umfeld betreffenden Transformationserfahrungen und auch Zukunftserwartungen sehr viel positiver gesehen als jene für Deutschland insgesamt.